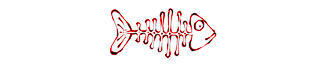Neulich war ich beim Arzt. Lange hatte ich um diesen Termin gekämpft. Und wäre es nichts Akutes gewesen, weswegen ich im September in der Praxis angerufen hatte, hätte ich ihn wohl nicht schon im Dezember bekommen – eine echte Vorzugsbehandlung also. Ich fühlte mich sogleich ungeheuer wichtig und versuchte, die dazwischenliegenden drei Monate irgendwie zu überleben, um den Arzt ja nicht durch plötzliches und unmotiviertes Dahinscheiden um einen Krankenschein zu prellen.
Mit letzter Kraft schleppte ich mich am Tag X in die Praxis, um von der Sprechstundenhilfe zunächst nachdrücklich ignoriert zu werden. Ihre Computertastatur, ihre Fingernägel und die Kaffeetasse waren allesamt interessanter als ich. Ich aber war nicht bereit, so kurz vor der Zielgeraden einfach aufzugeben – ich fixierte sie mit meinem Blick und wartete. Nach gefühlten 20 Minuten sah sie auf, kein bisschen überrascht, mich zu sehen, und verlangte meine Versichertenkarte. Anschließend bedeutete sie mir, im Wartebereich Platz zu nehmen. Dabei fuchtelte sie gelangweilt in eine unbestimmte Richtung den Gang hinunter. Ihrer Richtungsangabe folgend, lief ich schnurstracks am Wartezimmer vorbei – ich hatte es für einen Wandschrank gehalten.
Im Inneren dieses Wandschrankes fand ich fünf Stühle vor, einen schmalen Tisch mit ziemlich alten Zeitungen und eine Wanduhr. Drei der Stühle waren besetzt, ich quetschte mich auf einen der beiden freien Stühle zwischen die bereits Wartenden. Die Minuten verstrichen. Die Stunden auch. Unerbittlich rückten die Zeiger der Wanduhr vor. Die Geräusche, die sie dabei machten, vermischten sich mit meinem Magenknurren (ich hatte seit dem Frühstück, das aus der üblichen Tasse Kaffee bestand, nichts zu mir genommen) und dem hörbaren Schnaufen meines Nachbarn zur Linken, der dabei gleich noch einen Schwall Knoblauchduft mit ausdünstete. Dies wurde sogleich neutralisiert von meinem Nachbarn zur Rechten, der die vergangene Woche vermutlich im Fitnessstudio verbracht und noch keine Zeit gefunden hatte, die Kleidung zu wechseln.
Gerade, als ich nachschauen wollte, ob in der Praxis noch irgend jemand außer uns am Leben war (und auch bei mir konnte es sich nur noch um Stunden handeln), kam Bewegung in die Sache: die Eingangstür wurde aufgestoßen, und ein Privatpatient wurde in einer Sänfte am Wandschrank vorbeigetragen, dicht gefolgt von zwei maximalpigmentierten Leibeigenen, die emsig bestrebt waren, ihrem Gebieter mittels eines großen Palmwedels Luft zuzufächeln, damit die rasante Vorwärtsbewegung keine Reibungshitze erzeugen möge. Sogleich verschwand der Privatpatient in einem Behandlungszimmer, in dem er die folgenden 50 Minuten verbrachte. Als sich die Tür wieder öffnete und die Sänfte sich auf den Rückweg machte, sah ich den Arzt glücklich lächelnd im Türrahmen lehnen, die Augen geformt wie zwei Registrierkassen. Ich hätte schwören können, dass darauf Dollarzeichen zu erkennen waren. An ihm vorbei erhaschte ich einen Blick in das Behandlungszimmer – dicke Perserteppiche, schwere rote Samtsessel, einen Gobelin an der Wand.
Nach weiteren zwei Stunden und einer Mittagspause waren sowohl der Knoblauchpinscher als auch der Naturbursche aus dem Wandschrank verschwunden; ich teilte mir das Refugium jetzt nur mit dem Etwas mir gegenüber (eine geschlechtsspezifische Bestimmung ist mir leider nicht möglich), das sich inzwischen seiner Turnschuhe entledigt hatte. Halb betäubt, stemmte ich mich hoch und versuchte, mir die Beine zu vertreten und dabei ein wenig Luft zu schnappen. Einen Hintergedanken hatte ich ja doch – ich wollte mal sehen, wie denn das Wartezimmer für die nicht der Gesundheitsreform unterliegenden Privatpatienten aussieht. Pech gehabt – es gab keines. Wozu auch, Privatpatienten brauchten ja nicht zu warten.
Dann endlich, nachdem ich bereits in Gedanken mein Testament aufgesetzt hatte, wurde ich ins Sprechzimmer gerufen. Statt des oben erwähnten Interieurs erblickte ich einen wackligen Hocker, einen PVC-Boden und an der Wand einen Ölschinken mit röhrendem Hirsch. Der Arzt kam herein und fragte mich nach dem Grund meines Besuches. Ich schilderte ihm mein Anliegen, er schaute mich prüfend an und meinte dann: „Ich werde Ihnen ein Privatrezept ausstellen. Sie werden verstehen, dass das auf Krankenkasse nicht geht – wir haben jetzt Dezember, und mein Budget ist bereits erschöpft. Warum sind Sie damit nicht schon im September zu mir gekommen?“
Foto © Marco Verch, Creative Commons 2.0